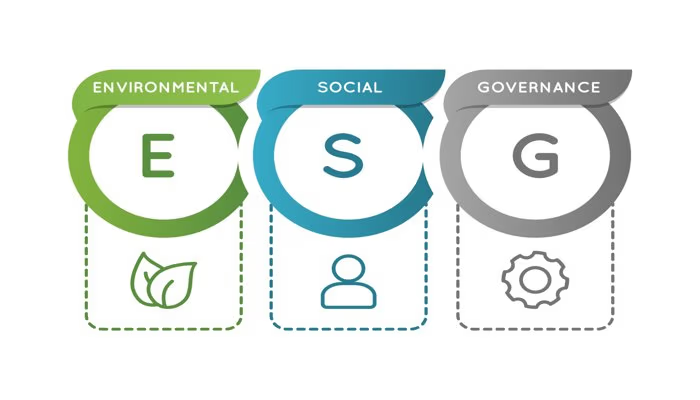Zusammenfassung: Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gewinnt ESG-Reporting deutlich an Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte nachvollziehbar, vergleichbar und strukturiert offenzulegen. Dafür sind bereichsübergreifende Zusammenarbeit, fachliche Tiefe und eine klare Dokumentation erforderlich. Die doppelte Wesentlichkeit ist dabei zentral: Welche Themen sind für das Unternehmen und für die Gesellschaft relevant? Welche Risiken und Chancen ergeben sich daraus? Zugleich steigt der externe Druck – Investoren, Kunden und Aufsichtsbehörden erwarten verlässliche ESG-Daten. Die European Sustainability Reporting Standards (ESRS) bieten dafür einen verbindlichen Rahmen. ESG-Reporting wird so zu einer zentralen Aufgabe, um Transparenz zu schaffen und Vertrauen bei Stakeholdern zu gewinnen.
Was ist ESG-Reporting?
ESG-Reporting ist die strukturierte und transparente Berichterstattung von Unternehmen über ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken. Es umfasst die Erfassung und Offenlegung relevanter Daten zu Themen wie Umweltschutz, soziale Verantwortung, Arbeitsbedingungen, Unternehmensführung und ethische Standards. Ziel des ESG-Reportings ist es, die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens zu dokumentieren und dessen Performance in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Governance zu bewerten. ESG-Berichte helfen Unternehmen, ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, Investoren und anderen Stakeholdern zu kommunizieren, und bieten eine Grundlage für die Bewertung von Risiken und Chancen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Sie dienen der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und stärken das Vertrauen von Investoren, Kunden und Öffentlichkeit.
Was beinhaltet ESG-Reporting?
Ein ESG-Report dient der transparenten Darstellung der ökologischen, sozialen und unternehmerischen Verantwortlichkeiten eines Unternehmens. ESG steht für Environmental, Social und Governance. Das Reporting umfasst daher:
Environmental
Unternehmen müssen klar darlegen, wie sie zu Nachhaltigkeit und zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen, den CO2-Ausstoß reduzieren, die biologische Vielfalt erhalten und Abfall umweltgerecht entsorgen. Fragen wie „Wie trägt das Unternehmen zur Verringerung von Emissionen bei?“ und „Welche Schritte werden zur Verbesserung der Wasser- und Luftqualität unternommen?“ sind entscheidend für das Reporting.
Social
Im sozialen Bereich geht es um die Förderung der Mitarbeitenden, Verbesserung des Arbeitsschutzes, Gleichstellung der Geschlechter und den Schutz von Menschenrechten in der Lieferkette. Fragen zur Sicherheit am Arbeitsplatz, zur Förderung von Diversity und zur Wahrung von Arbeitnehmerrechten sollten behandelt werden.
Governance
Dieser Bereich dreht sich um die Prinzipien und Strukturen, die das Unternehmen in Bezug auf ethische Geschäftspraktiken und Transparenz leiten. Hier geht es um Unternehmensethik, die dafür sorgt, dass das Unternehmen im Einklang mit moralischen und sozialen Standards handelt. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist die Korruptionsprävention, die das Vertrauen in die Integrität des Unternehmens stärkt. Ebenso entscheidend ist die Compliance, die dafür sorgt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zuverlässig eingehalten werden.
Möchten Sie Ihr ESG-Reporting effizienter gestalten?
Mit EHS-Software optimieren Sie Ihre Prozesse und vereinfachen die Dokumentation
Der Prozess: Wie entsteht ein ESG-Bericht?
Die Erstellung eines ESG-Reports folgt keinem starren Schema, dennoch haben sich in der Praxis strukturierte Vorgehensweisen bewährt. Da die EU-Kommission keine einheitliche Berichtsvorlage vorgibt, sind klare interne Prozesse entscheidend:
1. Festlegung einer unternehmensspezifischen ESG-Ausrichtung:
Zu Beginn steht die strategische Verankerung: Welche ESG-Ziele verfolgt das Unternehmen, welche Themen sind langfristig relevant?
2. Systematische Erfassung aller relevanten ESG-Daten
Anschließend werden alle quantitativen und qualitativen Informationen zusammengetragen – aus Umweltmanagement, Personalwesen, Compliance und weiteren Bereichen.
3. Definition berichtsrelevanter ESG-Themen und Kennzahlen
Im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse wird entschieden, welche Themen und KPIs tatsächlich in den Bericht aufgenommen werden – gemäß dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit.
4. Abgleich mit bestehenden Reporting-Standards
Um eine klare und einheitliche Struktur zu gewährleisten, werden etablierte Rahmenwerke wie die ESRS (European Sustainability Reporting Standards), GRI (Global Reporting Initiative) oder SASB (Sustainability Accounting Standards Board) verwendet. Welches Framework angewendet wird, hängt von der Branche des Unternehmens und dem spezifischen Zweck des Berichts ab.
5. Erstellung und Integration des ESG-Berichts
Im letzten Schritt erfolgt die formale Ausarbeitung des Berichts. Je nach Unternehmensgröße kann dies als eigenständiges Dokument oder Teil des Lageberichts erfolgen. Dabei ist eine professionelle ESG-Software unverzichtbar.
Vorteile des ESG-Reporting für Unternehmen
Ein ESG-Report bietet nicht nur regulatorische Absicherung, sondern verbessert gezielt die strategische Position eines Unternehmens – unabhängig davon, ob bereits eine gesetzliche Pflicht besteht.
Externe Vorteile
Verbesserte Bewertung durch ESG-Ratingagenturen und nachhaltigkeitsorientierte Investoren
Höhere Transparenz gegenüber Kapitalmarkt, Aufsichtsbehörden und Öffentlichkeit
Reputationsgewinn und Vertrauensbildung bei Geschäftspartnern und Kunden
Wettbewerbsfaktor bei öffentlichen Ausschreibungen und in globalen Lieferketten
Unterstützung bei der Erfüllung internationaler Berichtsanforderungen (z. B. EU-Taxonomie, SFDR)
Interne Vorteile
Frühzeitige Identifikation von Risiken, z. B. durch Klimawandel oder Lieferkettenprobleme
Grundlage für strategische Entscheidungen auf Basis konsistenter ESG-Daten
Verbesserte bereichsübergreifende Zusammenarbeit durch standardisierte Prozesse
Erhöhte Attraktivität als Arbeitgeber durch dokumentiertes Engagement für soziale und ökologische Themen
Potenzial zur Prozessoptimierung und Senkung von Energie-, Ressourcen- und Compliance-Kosten
Risiken unzureichender ESG-Nachvollziehbarkeit
Fehlende Transparenz bei ESG-Angaben kann schnell zu Greenwashing-Vorwürfen führen – und damit zu erheblichen Reputationsschäden. Insbesondere in sozialen Medien verbreitet sich Kritik rasch, und auch Boykottaufrufe sind keine Seltenheit. Unternehmen, die Nachhaltigkeit kommunizieren, müssen ihre Aussagen durch nachvollziehbare Daten und Strategien untermauern.
flowdit: Klare Prozesse für belastbare ESG-Berichte
ESG-Reporting nach CSRD ist kein reiner Verwaltungsakt. Wer die Anforderungen strategisch angeht, schafft Transparenz und legt die Basis für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Die Erhebung, Strukturierung und Pflege von ESG-Daten ist komplex; insbesondere bei abteilungsübergreifenden Prozessen. Digitale Tools beschleunigen diese Abläufe und verbessern gleichzeitig die Datenqualität.
Mit einer Software wie flowdit
lassen sich EHS-Reports effizient erstellen: Checklisten, Aufgabenverteilung, Datenerfassung und Fortschrittskontrolle
greifen nahtlos ineinander. Das System unterstützt bei der strukturierten Umsetzung der ESRS-Anforderungen und
reduziert den manuellen Aufwand deutlich. Unternehmen gewinnen dadurch Zeit, Klarheit und Sicherheit im Reporting
und behalten gleichzeitig den Blick für das Wesentliche.
Finden Sie die besten EHS Software-Lösungen 2026 in unserem Vergleich.
FAQ | ESG Reporting
Für welche Unternehmen besteht eine Pflicht zur ESG-Berichterstattung?
Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, sind verpflichtet, ESG-Berichte zu erstellen. Compliance-Software kann hierbei helfen, die korrekte Dokumentation und Einhaltung der Standards sicherzustellen, indem sie alle relevanten Daten erfasst und organisiert.
Was bedeutet ESRS?
ESRS steht für European Sustainability Reporting Standards. Diese Berichtsstandards legen fest, welche Nachhaltigkeitsthemen Unternehmen offenlegen müssen. Sie wurden von der EU entwickelt und sind zentraler Bestandteil der neuen CSRD-Richtlinie. Die ESRS definieren Inhalte, Kennzahlen und Anforderungen zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung – und sorgen damit für vergleichbare und verlässliche Nachhaltigkeitsberichte in ganz Europa.
Wie lautete die Vorgängerrichtlinie der CSRD?
Die CSRD löst die NFRD (Non-Financial Reporting Directive) ab. Diese verpflichtete seit 2017 große Unternehmen zur Offenlegung nichtfinanzieller Informationen (z.B. zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, Menschenrechten, Korruptionsbekämpfung und Diversity). Mit der CSRD steigen die Anforderungen deutlich – sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die Zahl der betroffenen Unternehmen.
Welche Standards gelten aktuell für das ESG-Reporting?
Unternehmen, die der ESG-Berichtspflicht nach der CSRD unterliegen, müssen sich an die ESRS halten.
Diese Standards wurden von der EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) im Auftrag der EU-Kommission entwickelt, um die Nachhaltigkeitsberichterstattung einheitlich und vergleichbar zu gestalten. Sie legen detailliert fest, welche Inhalte offengelegt werden müssen und wie die Wesentlichkeit relevanter Themen zu bestimmen ist.
International existieren für das Reporting zudem Standards wie die Standards IFRS1 und IFRS2 des ISSB (International Sustainability Board)
Wie ist ein Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut?
Die ESRS geben einen klaren Rahmen für den Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichts vor. Im ersten Abschnitt machen Unternehmen grundlegende Angaben, z.B. zur strategischen Ausrichtung und Governance. Zudem wird erläutert, wie Auswirkungen gemanagt werden und wie Wesentlichkeit bewertet wird. Danach gliedert sich der Bericht in die drei ESG-Bereiche: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Themen, die nach einer Prüfung als nicht relevant eingestuft wurden, können ausgelassen werden.
Wie funktioniert die Wesentlichkeitsanalyse im ESG-Reporting?
Die Wesentlichkeitsanalyse prüft, welche ESG-Themen für ein Unternehmen berichtspflichtig sind. Dabei gilt der Grundsatz der doppelten Wesentlichkeit: Ein Thema ist relevant, wenn es entweder bedeutende Auswirkungen auf Umwelt oder Gesellschaft hat – oder finanziell wichtig für das Unternehmen ist. Mindestens eines der beiden Kriterien muss erfüllt sein. Dies verringert den Umfang der Berichtspflicht, gleichzeitig steigt jedoch der Anspruch an die Wesentlichkeitsanalyse: Unternehmen müssen systematisch darlegen, warum bestimmte Themen als nicht wesentlich eingestuft und somit ausgelassen wurden.
Welche sozialen Aspekte umfasst ESG konkret?
Im Bereich „Soziales“ sind gemäß ESRS insgesamt 32 KPIs definiert, die Unternehmen zur Bewertung und Offenlegung sozialer Themen heranziehen können. Dazu zählen:
Achtung der Menschenrechte entlang der Lieferkette
Faire Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Gleichstellung, Inklusion und Diversität
Zugang zu Weiterbildung
Datenschutz
Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit
Soziales Engagement im Umfeld
Welche ESG-Kennzahlen sind in der Praxis besonders relevant?
Environmental
Menge an CO₂-Emissionen (z. B. pro Jahr oder pro Produkt)
Energieverbrauch (absolut und anteilig aus erneuerbaren Quellen)
Wasserverbrauch (Gesamtmenge, Effizienz pro Produktionseinheit)
Abfallmenge (differenziert nach Recyclingquote, Sondermüll etc.)
Social
Arbeitsunfälle und Verletzungsraten -Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
Anteil von Frauen in Führungspositionen
Aus- und Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter
Mitarbeiterzufriedenheit (z. B. durch Befragungsergebnisse oder Fluktuationsrate)
Governance
- Anzahl von Verstößen gegen ethische Richtlinien – z. B. Korruption oder Kartellrecht
- Unabhängigkeit im Aufsichtsrat
Was sind IROs?
IROs stehen für Impacts (Auswirkungen), Risks (Risiken) und Opportunities (Chancen). Unternehmen müssen im ESG-Bericht offenlegen:
Welche Auswirkungen sie auf Umwelt und Gesellschaft haben
Welchen Nachhaltigkeitsrisiken sie ausgesetzt sind
Welche Chancen durch nachhaltiges Handeln entstehen
Was sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)?
Die 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden 2015 von den Vereinten Nationen festgelegt, um bis 2030 folgende Ziele zu erreichen: Armut bekämpfen, Umwelt und Klima schützen sowie soziale Gerechtigkeit fördern. Sie bilden den globalen Rahmen für nachhaltiges Handeln von Staaten, Unternehmen und Gesellschaft.
Für welche Unternehmen besteht eine Pflicht zur ESG-Berichterstattung?
Die Pflicht zum ESG-Reporting betrifft in erster Linie große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Finanzinstitute und Versicherungen mit mehr als 500 Mitarbeitenden. Ab 1.Januar 2025 wurde der Anwendungsbereich jedoch durch die CSRD erweitert: Mittelständische Unternehmen sind jährlich zu einem ESG-Bericht verpflichtet, wenn sie mehr als 250 Beschäftigte, über 40 Millionen Euro Umsatz oder über 20 Millionen Euro Bilanzsumme aufweisen.
Was passiert, wenn Unternehmen die ESG-Pflicht ignorieren?
Unternehmen, die ihrer ESG-Berichtspflicht nicht nachkommen, riskieren Sanktionen wie Bußgelder oder Zwangsgelder – abhängig von der nationalen Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Zudem kann ein fehlender Bericht das Vertrauen von Investoren, Kunden und Geschäftspartnern beeinträchtigen.
Image: Adobe Stock – Copyright: © Tasha Vector – stock.adobe.com